Dieses Bild teilen über:
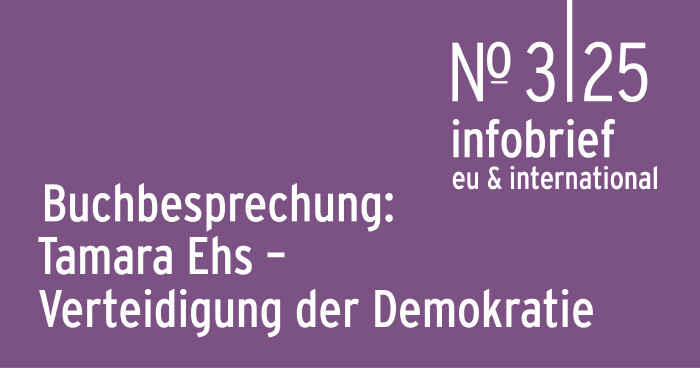
In ihrem Buch „Verteidigung der Demokratie“ geht Tamara Ehs der Frage nach, wie sich der aktuelle Vertrauensverlust in die Regierungsform der Demokratie begründen, aber auch, wie sich Vertrauen wiederherstellen lässt. Ihre These: Um wirksam für die Demokratie zu kämpfen, müssen ihre Voraussetzungen verteidigt werden.
Autor Felix Mayr
Diesen Artikel downloaden
„Wozu soll ich die Demokratie verteidigen?“ Diese Frage, gestellt von einem jungen Menschen, stellt den Ausgangspunkt für das jüngste Buch der Politikwissenschafterin Tamara Ehs dar. Daraus lassen sich bereits mehrere Folgefragen abgleiten: Denn welche Demokratie verteidigen wir denn genau? Und wer ist es, die:der die Demokratie verteidigt? Immerhin wird auch von rechtsextremen Bewegungen das Ziel verfolgt, die Demokratie (z.B. vor „den Eliten“) zu verteidigen. Weiters muss gefragt werden, was der Zweck dieser Verteidigung sein soll. Muss die Demokratie zurück in einen früheren, von manchen romantisierten Zustand überführt werden? Denn Ehs weist darauf hin, dass der damalige Wirtschaftsaufschwung mittels einer Unterschichtung durch Gastarbeiter:innen bewirkt wurde, die wiederum nicht am Aufschwung der Demokratie beteiligt wurden.
Gemäß dem Zitat des deutschen Staatsrechtlers Böckenförde, wonach „der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht schaffen kann“, braucht es laut Ehs mehr als das bloße Durchführen von Wahlen – es brauche eine starke Zivilgesellschaft, freie Medien, parlamentarische Oppositionsrechte und eine unabhängige Justiz. Eben für diese Vielzahl an Einbettungen gelte es zu kämpfen, wolle man für die Demokratie kämpfen. Man verteidigt laut Ehs somit streng genommen stets die Voraussetzungen für die Demokratie, wenn man die Demokratie verteidigt. In eben diese Kerben schlagen jedoch jüngere Angriffe wie die Delegitimierung von (Straf-)Verfahren gegen Politiker:innen als „Hexenjagd“, die empfundene Einschränkung der Meinungsfreiheit („Man darf nichts mehr sagen“) sowie Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen, die von der unterlegenen Seite in der Bevölkerung genährt werden.
Die Demokratie kann aber nicht nur von der Zivilgesellschaft, sondern muss auch von Entscheidungs- und Funktionsträger:innen verteidigt werden. Ehs schlägt somit politische Bildung nicht nur für Jugendliche, sondern als lebenslanges Lernen begriffen auch und gerade für Funktions- und Entscheidungsträger:innen vor; denn Populismus werde „von oben nach unten“ vorangetrieben. Umgekehrt behauptet die Expertin aber recht pauschal, dass „Richter:innen oder Polizist:innen die Demokratie unmittelbar verteidigen“. Auf systematisches Fehlverhalten der Polizei wie mangelhaft geahndete Polizeigewalt, „racial profiling“ oder die Tatsache, dass je nach politischer Zugehörigkeit der Betroffenen mit offenbar unterschiedlichem Maß gemessen wird, geht die Autorin an dieser Stelle nicht ein. Auch am Beispiel des prominenten Postenschachers am Bundesverwaltungsgerichtshof ist diese Aussage wohl mit Skepsis zu lesen. Immerhin ist das Auswahlverfahren zum Richter:innenamt nach wie vor von höchster Intransparenz gekennzeichnet und dadurch bewirkte „Richter:innendynastien“ in Österreich keine Seltenheit, die einen Ausschluss von gewissen Teilen der Gesellschaft an der Rechtsprechung bewirkt.
Im Buch behauptet Ehs, dass „die Demokratie beziehungsweise die Überzeugung von Demokratie […] von wirtschaftlichem Wachstum abhängig“ ist. Diese These mag befremden, stellt doch gerade eine verfehlte Wirtschaftspolitik, die zu exzessivem Reichtum bei einigen wenigen führt, eine der wesentlichen Bedrohungen der Demokratie heute dar. In einem Essay, der auf die Verteidigung der Demokratie abzielt, stellt sich in diesem Zusammenhang zwangsläufig die Frage, vor wem oder was denn die Demokratie verteidigt werden muss. Ein Beispiel für die Bedrohung der Demokratie durch extremen Reichtum stellen dabei sogenannte „Tech Bros“ wie insbesondere Elon Musk dar, der sich prominent nicht nur im heimischen, sondern auch in ausländischen Wahlkämpfen zugunsten von antidemokratischen Bewegungen einsetzte. Die Bedrohung der Demokratie durch wirtschaftliche Partikularinteressen thematisiert die Expertin jedoch nicht. Sie stellt vielmehr fest, dass jüngere Menschen in einer „Kultur der Enttäuschung“ leben würden, da sie ein wirtschaftliches Wachstum wie jenes in früheren Jahrzehnten nicht mehr erleben werden würden. Nur: Ob es tatsächlich die versagte Aussicht auf wirtschaftliches Wachstum ist, das (nicht nur) die jüngere Generation frustriert, enttäuscht und hoffnungslos zurücklässt?
Im Zusammenhang mit der nach wie vor ungelösten ökologischen Frage behandelt Ehs hier den zunehmenden Wunsch insbesondere jüngerer Menschen nach einer „Ökodiktatur“, um gegenwärtige Krisen zu bewältigen. Laut der Autorin ist dies als ein Misstrauen gegenüber der Demokratie als solche zu werten. Nun muss die Demokratie in ihrem Streben nicht notwendigerweise vernunftgetrieben sein. Es ist aber umgekehrt hinterfragbar, ob man einem System sein Vertrauen schenken darf, dass offenkundig irrational agiert und nicht länger ein sicheres, friedvolles und gleiches Miteinander – als ursprüngliches Versprechen der Demokratie – garantiert. Denn womöglich ist es nicht so sehr die Demokratie, die sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat als vielmehr die Übermacht eines globalen Wirtschaftssystems, dem sich eine jede (einzel- wie überstaatliche) Demokratie zu fügen hat und damit eine gewisse Machtlosigkeit unserer derzeitigen Demokratie offenbart.
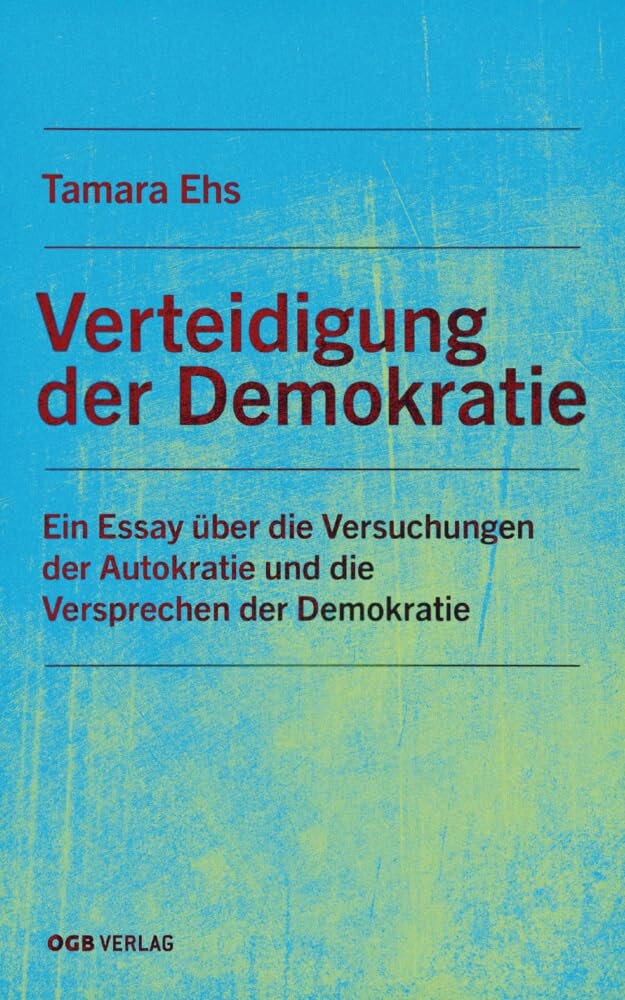
Tamara Ehs
Verteidigung der Demokratie
ÖGB Verlag, 2025
Zur Autorin: Tamara Ehs lehrte und forschte an zahlreichen internationalen Universitäten. Im Jahr 2025 ist sie Fellow der Academy of International Affairs in Bonn und forscht über Städtediplomatie zur Verteidigung der Demokratie. Ihre Forschung und Publikationen konzentrieren sich auf demokratische Innovationen und verfassungsrechtliche Sicherungen der Demokratie in Österreich, Deutschland und auf EU-Ebene, mit dem Fokus auf soziale Ungleichheit und die Gefahren der Autokratisierung.
Ehs führt den nicht unwesentlichen Anteil von Nichtwähler:innen, insbesondere aus dem untersten ökonomischen Drittel an, die sich nicht „freiwillig“ aus der Partizipation zurückgezogen haben. Gemäß der Aussage „die da oben richten es sich eh“ würden diese die Mitwirkung an politischen Verständigungsinstrumenten als vergebens ansehen, da es „an der eigenen Lage ohnehin nichts ändere“. Die Autorin weist dabei auch auf eine Untersuchung von zehn europäischen Staaten (darunter Österreich) hin, in welcher bestätigt wurde, dass sich die Demokratie in den untersuchten Staaten generell an den Interessen der Wohlhabenden orientiert orientiert und Schlechtergestellte nur dann berücksichtigt, wenn sich deren Interessen mit jenen der Wohlhabenden decken. Nur: Ist damit der unfreiwillige Rückzug aus der Partizipation schon gerechtfertigt?
Und was ist schließlich mit jenen dauerhaft in Österreich lebenden Menschen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind? In Österreich betragen diese immerhin 20 % der Gesamtbevölkerung, in Wien sogar 30 %. Ehs fragt hier „wie viel Ausschluss eine Demokratie verträgt, bevor sie nicht mehr Demokratie genannt werden kann“ und schlägt etwa eine Entkoppelung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft oder eine Senkung der (weltweit gesehen zu den strengsten gehörenden) Bestimmungen zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft vor. Sie weist auf die Wichtigkeit hin, die Repräsentation von Migrant:innen – aber auch Frauen oder Personen unter 40 – im Nationalrat an die realen Gegebenheiten und Verhältnisse anzupassen. Denn wenn Abgeordnete soziale Realität nicht aus eigener Erfahrung kennen, hat dies direkte Folgen für die Politikgestaltung. Dass diese Reformen in Übereinstimmung mit obiger These erwartungsgemäß eben nicht umgesetzt werden, da sie nicht mit den Interessen der Wohlhabenden übereinstimmen, steht stellvertretend für die praktischen Schwierigkeiten in der Umsetzung mancher der präsentierten Lösungsansätze.
Ehs verallgemeinert womöglich den aktuellen Vertrauensverlust in die Demokratie als Ganzes, ist ein solcher Verlust doch immer an konkreten, tatsächlich vorhandenen Schwachstellen des jeweiligen Systems festmachbar und berechtigt. Interessant wäre hier neben der Frage, ob man der Demokratie vertraut, aber auch jene gewesen, ob man ihr denn glaubt – denn mit Verweis auf obig Angeführtes können z.B. wohlhabende Menschen oder Staatsbürger:innen unserer Demokratie durchaus vertrauen, gleichzeitig aber um den bloßen Anschein „echter“ Partizipation bzw. den ungleich verteilten Schutz wissen, den unsere Institutionen ihnen bieten. Vertraut man also bereits der Demokratie, nur weil man sich den Schutz des eigenen Status oder gar Privilegien von ihr erwartet?
Ein spannender Aspekt, den der Essay in diesem Zusammenhang nicht abdeckt, ist das Phänomen „soziale Medien“ und ihre soziologischen Aspekte und Folgeerscheinung, können doch „soziale Medien“ wohl als das bestimmende Merkmal jüngerer Politik- und Kulturgeschichte gewertet werden. Expert:innen warnen seit geraumer Zeit vor der Gefahr für die Demokratie, die von „sozialen Medien“ ausgeht. Kann es vor dem Hintergrund des aktuell stattfindenden, globalen Rechtsrucks immerhin ein Zufall sein, dass negative Meldungen – und damit populistische Kampagnen, die Emotionen wie Unzufriedenheit, Hass oder Ungerechtigkeitsempfinden befördern – weit mehr Aufmerksamkeit generieren als hoffnungsfrohe Botschaften oder solche, die zu solidarischem Handeln ermuntern? Plattformen wiederum profitieren von diesen populistischen Negativkampagnen, die ihnen in Form von Aufmerksamkeit ein nicht unwesentliches Einkommen bescheren. Was macht es mit der Erwartungshaltung an die Politik, Politiker:innen und Nachrichten (als „vierte Gewalt“), wenn diese als ein Beitrag unter vielen zwischen Werbung und Influencer:innen mit diesen um Aufmerksamkeit – oft in einer konsumorientierten Erwartungshaltung – zu konkurrieren haben? Und was macht es mit uns als Gesellschaft und der Belastbarkeit unserer Überzeugungen, wenn „Diskurs“ lediglich in eingegrenzten Filterblasen oder Onlineforen stattfindet? Ähnlich wie bei exzessivem Reichtum – hier sogar in seiner Extremform weitgehend kongruent – scheinen Gefahren für die Demokratie, Umwelt und die soziale Absicherung ganzer Gesellschaftsschichten sodann zum Nebenschauplatz zu verblassen. Angesichts dieser Problemstellungen könnte paradoxerweise ins Treffen geführt werden, dass, um für „die Demokratie“ zu kämpfen, unser aktuelles System mitsamt seinen Schwachstellen gerade eben nicht blind verteidigt werden dürfe, sondern an Lösungen gearbeitet werden muss, die aktuellen Bedrohungen tatsächlich die Stirn zu bieten vermögen.
Diesen Artikel downloadenAbteilung EU & Internationales
Prinz Eugenstraße 20-22
1040 Wien
Telefon: +43 1 50165-0
- erreichbar mit der Linie D -
© 2026 AK Wien | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65