Dieses Bild teilen über:
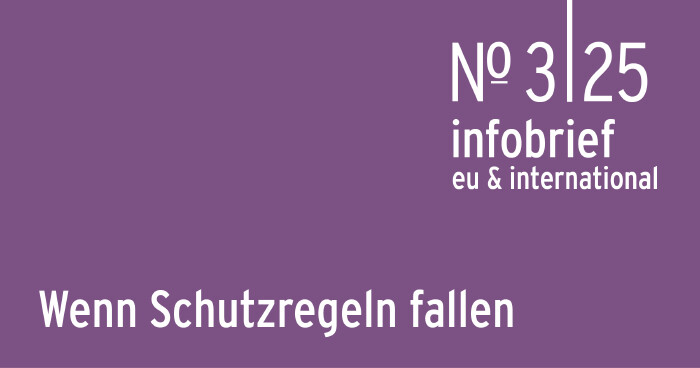
Eine beispiellose Deregulierungswelle droht Europas Gesetze und Schutzregeln abzuschwächen und den Gesetzgebungseinfluss anfälliger für einseitigen Lobbyeinfluss von Konzernen zu machen. Hintergrund ist eine breite Lobbykampagne der Industrie. Einflussreichen Unternehmensverbänden und Konzernen sind die vergleichsweise hohen europäischen Schutzstandards bei Umwelt, Verbraucherschutz und Arbeitnehmer:innenrechten schon länger ein Dorn im Auge.
Autor:innen: Nina Katzemich, Max Bank und Felix Duffy
Diesen Artikel downloaden
In Brüssel nimmt eine politische Agenda Fahrt auf, die Unternehmen weitreichende Erleichterungen verschaffen soll – indem sie bestehende Schutzregeln abbaut. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von der Industrielobby. Zentrale Akteure sind etwa der mächtige europäische Chemieverband CEFIC, der Lobbyverband der europäischen Arbeitgeberverbände BusinessEurope und der Bundesverband der deutschen Industrie BDI. Rückenwind kommt aus der deutschen Politik von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU).
Diese neue Deregulierungsagenda ist in den deutschsprachigen Mitgliedsstaaten bislang kaum bekannt. Dabei markiert sie einen politischen Wendepunkt. Der folgende Beitrag soll aufzeigen, worum es geht – und wer davon profitiert.
In ihrer ersten Amtszeit setzte Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Regulierung: mit dem European Green Deal, digitalen Grundsatzgesetzen und dem EU-Lieferkettengesetz. Ziel war es, Menschenrechte, die Umwelt, unsere Daten und das Klima wirksam zu schützen.
Jetzt wird diese Politik grundsätzlich in Frage gestellt. Der neue Fokus lautet „Wettbewerbsfähigkeit“. Gemeint ist damit aber vor allem eines – weniger Regulierung. Hohe Standards gelten plötzlich als Standortnachteil. Selbst nationale Sozial- und Arbeitsstandards geraten ins Visier. Die EU wolle mit China und den USA mithalten, heißt es – doch statt Innovation zu fördern, sollen Regeln weichen.
Die Richtung gibt die Industrie vor – etwa in der „Antwerp Declaration“ vom Januar 2024. Führende Wirtschaftsverbände, angeführt von der Chemieindustrie, forderten darin einen umfassenden Abbau von Pflichten und Vorschriften. Kommissionspräsidentin von der Leyen war bei der Vorstellung anwesend.
Ein Jahr später kündigte sie an, sämtliche zehn Empfehlungen der Erklärung in ihrer neuen Amtszeit aufzugreifen. Damit macht sich die Kommission zur politischen Vollstreckerin einer Agenda, die klar den Interessen großer Konzerne folgt – und zentrale Errungenschaften europäischer Schutzpolitik zur Disposition stellt.
Was sich als „Agenda für Wettbewerbsfähigkeit“ präsentiert, ist in Wahrheit eine systematische Schwächung europäischer Schutzstandards – im Namen von Wachstum und Profit. Die Kommission greift dabei auf bestehende Instrumente der sogenannten „besseren Rechtssetzung“ zurück, wie das Regulatory Scrutiny Board und die Refit-Plattform. Doch der neue Vorstoß geht weiter: Er verbindet alte Strukturen mit neuer politischer Macht und Durchsetzungskraft.
Im Zentrum stehen sechs Begriffe, die technokratisch klingen, aber politischen Sprengstoff bergen:
Wettbewerbsfähigkeit, Vereinfachung, Omnibus, 28. Regime, Realitätschecks und Implementierungsdialoge. Was harmlos klingt, untergräbt in vielen Fällen bewährte Regeln
1. „Wettbewerbsfähigkeit“ – ein Kampfbegriff im Dienst der Industrie
Kaum ein Begriff ist so zentral für die aktuelle EU-Politik – und zugleich so vage. Gemeint ist meist: Unternehmen sollen von Regeln und Auflagen entlastet werden, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Der Impuls kam spätestens mit dem Bericht von Mario Draghi im Herbst 2024. Der Ex-EZB-Chef sah Europas Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr – eine Steilvorlage für Deregulierungsforderungen.
Anstelle echter Innovationsförderung zielt die Agenda jedoch auf das Absenken von Standards: bei Menschenrechten, Datenschutz, Nachhaltigkeit. Selbst Fusionskontrollen sollen gelockert werden, um „europäische Champions“ zu ermöglichen. Die Kosten für Umwelt, Beschäftigte und Verbraucher:innen – bisher von Unternehmen getragen – sollen künftig von der Allgemeinheit übernommen werden.
2. „Vereinfachung“ als Tarnbegriff für Abbau von Kontrolle
Offiziell spricht die Kommission von „Vereinfachung“ – doch spätestens mit ihrem Wettbewerbsfähigkeits-Kompass vom Januar 2025 wird klar, dass es um mehr geht. Die Kommission kündigte an, Regulierung künftig stärker auf „Vertrauen“ statt Kontrolle zu stützen.
In der Praxis heißt das: weniger Berichtspflichten, weniger Überwachung – bei ohnehin schon schwacher Durchsetzung. Beispiel: Datenschutz und Chemikaliensicherheit gelten als europäische Vorzeigeprojekte, werden aber kaum kontrolliert. Statt hier zu verbessern, will die Kommission weiter abbauen. Der VW-Abgasskandal zeigt, wohin solche Fehlanreize führen können.
3. Der „Omnibus“ rollt – Gesetze im Schnellverfahren
Ein zentrales Instrument der neuen Deregulierungsagenda sind die sogenannten Omnibus-Verfahren. Der Begriff klingt harmlos, steht aber in Brüssel für die gebündelte Überarbeitung ganzer Gesetzespakete – mit dem Ziel, Berichtspflichten zu senken, Vorschriften zu „vereinfachen“ und Standards zurückzudrehen. Es geht nicht um punktuelle Anpassungen, sondern um eine systematische Abschwächung ganzer Rechtsbereiche.
4. „28. Regime“ – Angriff auf soziale Standards
Besonders brisant ist der Vorschlag eines sogenannten „28. Regime“: Zusätzlich zu den 27 Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten sollen Unternehmen mit Standorten in mehreren EU-Staaten künftig unter einheitlichen – sprich: weniger strengen – Arbeits- und Sozialstandards agieren dürfen. Das würde nationale Schutzregelungen – etwa in Deutschland – aushöhlen. Der Europäische Gewerkschaftsbund warnt: Das Modell untergräbt bestehende Rechte und öffnet der Abwärtsspirale Tür und Tor.
5. Neue Formate für noch mehr Lobby-Einfluss
Mit „Implementierungsdialogen“ und „Realitätschecks“ hat die Kommission neue Formate eingeführt, um die Perspektive der Wirtschaft in Gesetzesprozesse einzuspeisen. In der Praxis dominieren große Konzerne diese Foren – zivilgesellschaftliche Akteure bleiben außen vor.
Offizielles Ziel ist es, „Belastungen“ für Unternehmen zu identifizieren. Damit entsteht faktisch ein Frühwarnsystem – für Wirtschaftsinteressen, nicht für Gemeinwohlbelange.
Das Prinzip ist einfach – aber folgenreich: Statt einzelne Gesetze anzupassen, bündelt die EU-Kommission mehrere Regelwerke eines Politikfelds und überarbeitet sie gleichzeitig. Das spart Verfahren – und beschleunigt politische Weichenstellungen. Die Parlamente bleiben formal eingebunden, doch der politische Druck wächst, alles „im Paket“ durchzuwinken.
Weitere Omnibus-Verfahren sind bereits angekündigt:
Omnibus-Verfahren bündeln komplexe, oft sehr unterschiedliche Regelungen – und machen ihre politische Bearbeitung schwer durchschaubar. Sie verringern die Möglichkeit zur demokratischen Kontrolle und begünstigen Schnellverfahren. Gleichzeitig entsteht ein gefährlicher Präzedenzfall: Das Omnibus-Modell könnte zum neuen Standard für Gesetzesänderungen werden – zugunsten von Tempo, zulasten von demokratischen Prozessen und Teilhabe.
Während die Kommission den Zugang für Wirtschaftslobbyist:innen ausbaut, läuft im Europäischen Parlament eine Kampagne gegen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Vorangetrieben wird sie von konservativen und rechtsextremen Kräften, angeführt von der EVP.
Im Juni 2025 richtete das Parlament eine Arbeitsgruppe zur „Untersuchung der NGO-Finanzierung“ ein – gestützt auf unbelegten Vorwürfen. Ziel ist nicht Aufklärung, sondern Einschüchterung. Die Methoden erinnern an autoritäre Taktiken – und gefährden den demokratischen Diskurs.
Dieser Angriff hat das Ziel, zivilgesellschaftliche Organisationen – z.B. Umweltorganisationen – zu diskreditieren, indem man Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer Finanzierung sät. Ist ihr Ruf geschädigt, ist auch ihre Arbeit an gemeinwohlorientierten Zielen wie Klimaschutz oder der Schutz von Menschenrechten infrage gestellt. Das zahlt auf den Plan ein, die von ihnen mit erkämpften Regeln wieder einzukassieren.
Die Deregulierungsagenda der Industrie erhält entscheidende politische Unterstützung aus Deutschland. Bundeskanzler Merz sieht in Regulierung ein zentrales Wachstumshemmnis und begrüßt die neue Agenda ausdrücklich. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich in ihrer zweiten Amtszeit klar auf diesen Kurs verpflichtet – als Bedingung für ihre Wiederaufstellung durch CDU und CSU.
EVP-Fraktionschef Weber koordiniert den Rückhalt im Parlament. Im Januar 2025 bekräftigten alle drei in einer gemeinsamen Erklärung in Berlin ihr Vorhaben, „bürokratische Hürden“ abzubauen – gemeint sind vielfach Schutzregeln für Umwelt, Gesundheit und Soziales.
In einer Zeit globaler Unsicherheit braucht Europa Verlässlichkeit und Gemeinwohlorientierung. Doch die derzeitige Politik der EU-Kommission gefährdet beides: Sie schwächt Schutzstandards, vergrößert Machtungleichgewichte und diskreditiert kritische Stimmen.
Was als Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit ein gefährlicher Rückschritt – für den Schutz von Mensch und Umwelt, für demokratische Teilhabe und für das Vertrauen in politische Institutionen.
Dem müssen wir entgegentreten. Eine Politik, die Konzerninteressen priorisiert und zivilgesellschaftliche Kritik delegitimiert, darf sich nicht durchsetzen. Es braucht jetzt eine breite, entschlossene Gegenbewegung. Für starke Regeln. Für eine lebendige Demokratie. Für ein Europa, das nicht entfesselt wird – sondern handelt.
Diesen Artikel downloadenAbteilung EU & Internationales
Prinz Eugenstraße 20-22
1040 Wien
Telefon: +43 1 50165-0
- erreichbar mit der Linie D -
© 2026 AK Wien | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65