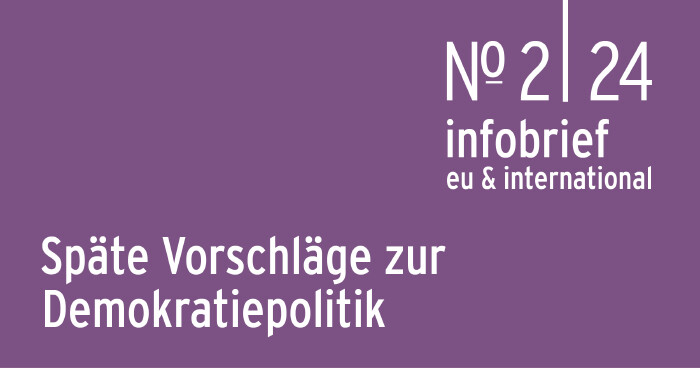
Demokratie versus Autokratien und Diktaturen: Vorschläge der EU-Kommission zur Demokratiepolitik massiv verspätet
Die Europäische Union steht am Scheideweg. Demokratien stehen in Gefahr, durch Autokratien und Scheindemokratien ersetzt zu werden. Populismus, Korruption und Naheverhältnisse einiger Politiker:innen zu diktatorischen Regimen stellen die Stabilität von Demokratien zunehmend infrage. Auch die Entwicklung in Drittstaaten gibt Anlass zu Sorge. Wie sich die Europäische Union demokratiepolitisch weiterentwickeln wird, hängt u.a. vom Ausgang der EU-Wahlen im Juni 2024 ab.
Autor: Frank Ey
Diesen Artikel downloadenDemokratiepaket: Licht…
EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen hat bereits zu Beginn ihrer Amtszeit mit einem Demokratiepaket Maßnahmen angekündigt, die zu einer Stärkung der Demokratien in der EU führen sollen. Tatsächlich wurden mehrere neue EU-Gesetze verabschiedet, die demokratiepolitisch zu begrüßen sind. Das neue EU-Medienfreiheitsgesetz stellt beispielsweise sicher, dass journalistische Arbeit besser geschützt wird. Medien sollen vor politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme geschützt werden. Medien müssen ihre Eigentumsverhältnisse offenlegen, es muss klar sein, wer die Medien kontrolliert. Öffentliche Medien müssen zudem redaktionell unabhängig arbeiten können. Medien müssen künftig auch über Werbung aus staatlichen Mitteln Auskunft geben, sowie über Werbegelder aus Drittstaaten. Dieses Gesetz geht auch Hand in Hand mit einer EU-Initiative gegen sogenannte SLAPP-Klagen: Bei dieser Methode versuchen Unternehmen und/oder Personen über rechtsmissbräuchliche Klagen gegen kritische Berichterstattung vorzugehen. Autor:innen bzw. Medien werden dabei mit Klagen eingedeckt, um diese einzuschüchtern und weitere Berichte zu verhindern. Es werden oft hohe Geldforderungen gestellt, häufig begleitet von Diffamierungen in der Öffentlichkeit. Merkmal ist weiters, dass es bei diesen Klagen an belastbaren Grundlagen fehlt und diese bei einem Verfahren dann auch vom Kläger nicht gewonnen werden. Mit dem neuen EU-Gesetz sollen SLAPP-Klagen verhindert werden.
Bereits im März 2024 wurde eine neue EU-Verordnung verabschiedet, die für mehr Transparenz bei politischer Werbung sorgen soll. Grundsätzlich ist die Initiative zu begrüßen, weil sie vorsieht, dass politische Anzeigen auch als solche deutlich gekennzeichnet werden müssen. Das sogenannte „Targeting“ bei politischer Werbung im Internet, also eine an die Person zielgerichtete Werbung, darf künftig nur nach Einwilligung der betroffenen Adressaten durchgeführt werden. Eine mögliche Einflussnahme aus dem Ausland soll zudem dadurch verhindert werden, dass es ab drei Monate vor der jeweiligen Wahl verboten sein wird, einschlägige Werbedienstleistungen für Sponsor:innen aus Drittländern zu erbringen. Was gut klingt, kommt jedoch erst nach den EU-Wahlen und u.a. auch nach den österreichischen Nationalratswahlen zur Anwendung: Die meisten Bestimmungen gelten nämlich erst ab Herbst 2025.
Weitere Maßnahmen wurden zudem gesetzt im Rahmen der Korruptionsbekämpfung, mit neuen Regeln zu Ethik und Transparenz im Europäischen Parlament und auch über das Gesetz über digitale Dienstleistungen, mit dem es eine bessere Handhabe gegen Fake-News und Hassnachrichten über soziale Medien gibt.
… und Schatten in der EU-Gesetzgebung
Beim Gesetz über Transparenz bei politischer Werbung zeigen sich die Probleme bei den Initiativen für eine stabile Demokratie deutlich: Obwohl das EU-Demokratiepaket bereits mit dem Antreten Von der Leyens als Kommissionspräsidentin angekündigt wurde, dauerte es Jahre, bis die Rechtsvorschläge veröffentlicht wurden. So wurden drei Rechtsinitiativen – eine Empfehlung über inklusive und stabile Wahlverfahren in der Union und bezüglich der EU-Parlamentswahlen, eine weitere Empfehlung zur Beteiligung der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungsprozessen und eine Richtlinie zur Transparenz der Interessenvertretung im Auftrag von Drittländern erst im Dezember 2023 veröffentlicht, also wenige Monate vor der EU-Wahl 2024. Die Chance, dass beispielsweise die Empfehlung zum stabilen und inklusiven Wahlverfahren in der Union und bei den EU-Wahlen verabschiedet und rechtzeitig umgesetzt wird, ist damit gering und wird genauso wie bei der Verordnung zur Transparenz bei politischer Werbung erst nach den EU-Wahlen relevant. Initiativen in Form einer Empfehlung sind zudem unverbindlich, müssen also in den Mitgliedstaaten nicht weiterverfolgt werden.
Gerade bei der Empfehlung hinsichtlich der Wahlverfahren geht es um zentrale Elemente, die für eine ordnungsgemäße und faire Wahl notwendig sind: Besprochen werden in der Empfehlung der Schutz der Wahlinfrastruktur sowie ein Schutz vor Cyberbedrohungen sowie Deep Fakes und der Schutz wahlbezogener Informationen. Leider bleibt die Kommission bei diesen Punkten ausgesprochen vage und unverbindlich, was den Wert des Kommissionstextes maximal schmälert.
Zudem ist nicht nachzuvollziehen, warum es derart lange dauerte, bis so zentrale Rechtsakte von der Kommission veröffentlicht wurden, obwohl die EU-Kommissionspräsidentin schon zu Beginn ihrer Amtszeit von einem neuen Schwung für die Demokratie gesprochen hat.
Leider fehlt es zudem nach wie vor an weiteren Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie wie einer Direktwahl der/des Kommissionspräsidentin/en durch die EU-Bevölkerung oder einem Initiativrecht des Europäischen Parlaments, das derzeit nur die Europäische Kommission hat. Auch das Mandat der Europäischen Zentralbank muss dringend überarbeitet und um die allgemeinen Ziele der Union samt Rechenschaftspflicht erweitert werden. Es braucht zudem eine Offensive bei politischer Bildung in allen Bildungseinrichtungen.
Interventionen einflussreicher Lobbyist:innen noch immer nicht im Griff
Ein neuer Bericht des Europäischen Rechnungshofes vom April 2024 zeigt, dass Lobbyist:innen trotz einschlägiger Maßnahmen gegen überbordendes oder gar illegales Lobbying nach wie vor über Umwege ihren Einfluss geltend machen können, ohne sich entsprechend deklarieren zu müssen. Wie problematisch das aus demokratiepolitischer Sicht ist, hat ein Fall gezeigt, bei dem ein Drittstaat aktuelle und ehemalige EU-Abgeordnete bestochen hat, in ihrem Sinne aktiv zu werden. Der Rechnungshof kritisiert unter anderem, dass bei Verstößen gegen das EU-Transparenzregister, in das sich Lobbyist:innen eintragen müssen, keine Strafen verhängt werden können. Der Grund dafür ist, dass das Register keinen Gesetzescharakter hat und es daher an einer Grundlage für Sanktionen fehlt. Allerdings: Das Europäische Parlament und die EU-Kommission können bei Lobbyist:innen, die gegen die Regeln des Registers verstoßen, grundsätzlich Besuchsverbote in deren Häusern aussprechen. Der Rechnungshof kritisiert insbesondere auch die Praxis, dass nicht registrierte Lobbyist:innen beispielsweise über Telefonanrufe und Emails nach wie vor einen wirkungsvollen Zugang zu EU-Entscheidungsträger:innen haben. Besonders heikel sind dabei sogenannte „spontane Treffen“ wie bei Konferenzen oder ähnliche Veranstaltungen, bei denen die Interessenvertreter:innen mit den Abgeordneten und Beamt:innen auf EU-Ebene sprechen können.
Die Arbeitnehmer:innenorganisationen teilen diese Kritik und fordern insbesondere, dass auch der Rat beim EU-Transparenzregister wird. Bislang ist er das nicht und es gibt kaum einen Überblick darüber, wer bei den Ratsmitgliedern und EU-Mitgliedsländern ein und aus geht.
Bedenkliche Entwicklungen in der Demokratiepolitik einzelner EU-Staaten
Wie wichtig eine stabile Demokratie mit klaren Regeln für eine faire und unabhängige Wahl ist, zeigen die politischen Entwicklungen in vielen Staaten außerhalb der Union, aber auch auf EU-Ebene. Am besorgniserregendsten ist in der Europäischen Union die Situation in Ungarn. In einer Entschließung spricht das Europäische Parlament Ungarn den Status einer Demokratie ab und bezeichnet es stattdessen als Wahlautokratie. Wahlen finden demnach zwar statt, aber demokratische Normen und Standards spielen dabei keine Rolle mehr. Kritisch äußert sich das EU-Parlament über den Rat, der es nicht schaffe, demokratiepolitischen Rückschritten entgegenzuwirken.
Das schärfste Instrument, um gegen EU-Mitgliedsländer vorzugehen, die gegen die Grundwerte der Union und gegen Grundprinzipien der Demokratie verstoßen, ist das sogenannte Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Kommt es zu einem derartigen Verstoß, kann die Europäische Kommission Mittel für den betreffenden Mitgliedsstaat aus dem EU-Budget sperren. Im Falle Ungarns wurden so rund 30 Mrd. Euro aus dem Kohäsions- und dem Wiederaufbaufonds eingefroren. Wenige Monate vor den EU-Wahlen hat Von der Leyen nun 10 Mrd. Euro an Geldern für Ungarn freigegeben. Beobachter:innen mutmaßen, dass der Sinneswandel etwas mit dem Veto Orbáns gegen die Ukraine-Hilfe zu tun hat, andere sehen darin ein Manöver Von der Leyens, um den ungarischen Premier für ihre Wiederwahl Ende 2024 als Kommissionspräsidentin auf ihre Seite zu ziehen. Das Europäische Parlament will die Kommission nun wegen der Mittelfreigabe für Ungarn verklagen. Auch andere EU-Länder haben in der Vergangenheit schon mit einem problematischen Umgang mit der Demokratie auf sich aufmerksam gemacht, darunter Polen und Slowenien. In diesen beiden Ländern ist es jedoch zu einem Machtwechsel mit neuen Regierungen gekommen, die nun dabei sind, die Rechtsstaatlichkeit in den beiden Ländern wiederherzustellen.
Regime und Diktaturen in Drittstaaten werden stärker
Zunehmend ins Hintertreffen kommt die Europäische Union in den letzten Jahren bei der Förderung von Demokratien in Drittstaaten. Zwar gibt es einen strategischen Rahmen zur Förderung von Demokratien in Drittstaaten, totalitäre Regime setzen sich aber immer mehr mit ihren Weltanschauungen durch. Ein Versäumnis, das sich nun zunehmend rächt: Die Europäische Union hat sich vor allem auf Handelsabkommen mit zahlreichen Drittstaaten konzentriert, dabei aber vergessen, dass bei den Beziehungen zu diesen Staaten auch politische Stabilität, vorzugsweise im Rahmen eines demokratischen Systems ganz essenziell ist. Ein besonderes Problem in den Beziehungen der EU zu Drittstaaten zeigt sich insbesondere in Afrika. Lange Zeit beuteten eine Reihe von EU-Mitgliedsländern afrikanische Staaten als Kolonialmacht auf teils menschenverachtende Weise aus. Politische Stabilität oder gar die Förderung von Demokratien spielte kaum je eine Rolle. Gerade in Frankreichs ehemaligen Kolonien Niger, Gabun, Mali, Burkina Faso und Guinea kam es nun zu einer Reihe von Militärputschen verbunden mit antifranzösischen Parolen. Stattdessen wenden sich Länder wie Niger totalitären Regimen wie Russland zu. So sind erst Mitte April 2024 hunderte Wagner-Kämpfer zur Unterstützung der neuen Militärherrschaft in Niger eingetroffen.
Mit Infrastrukturinvestitionen hat China wiederum zahlreiche afrikanische Länder an sich gebunden. Seit mehr als fünfzehn Jahren ist China entsprechend aktiv, während der Einfluss der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten auf Afrika stark zurückgeht. Abgesehen von den wirtschaftspolitischen Effekten ist diese Entwicklung vor allem demokratiepolitisch höchst problematisch, der Europäischen Union fehlen seit vielen Jahren entsprechende Konzepte.
EU-Demokratiepolitik – quo vadis?
Die Bestandsaufnahme zeigt, wie wichtig es ist, demokratische Strukturen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zu stärken. Die bevorstehenden EU-Wahlen sind in dieser Beziehung entscheidend dafür, wie sich die EU in den nächsten Jahren demokratiepolitisch weiterentwickeln wird.
Kontakt
Kontakt
Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien
Abteilung EU & Internationales
Prinz Eugenstraße 20-22
1040 Wien
Telefon: +43 1 50165-0
- erreichbar mit der Linie D -
