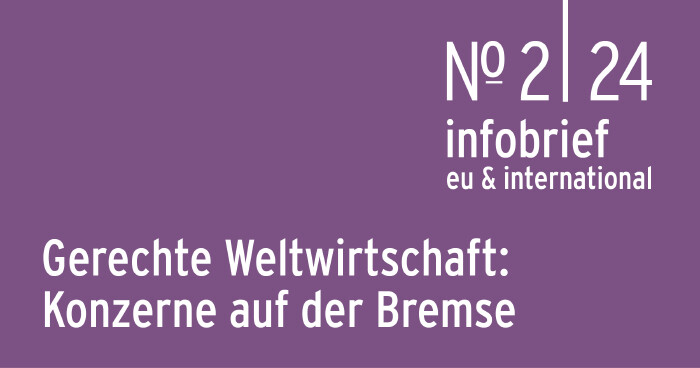
Gerechte Weltwirtschaft: Konzerne auf der Bremse
Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind vielfältig. Klimakrise, Wirtschaftskrise und Kriege haben verheerende Folgen und verschärfen die globale Ungleichheit. Die EU bedient allerdings immer noch die Interessen der Konzerne bei wichtigen politischen Entscheidungen. Mit gesellschaftlichem Druck von Gewerkschaften, NGOs und Interessenvertretungen sind dennoch Erfolge möglich. Als progressiver Akteur entpuppte sich einmal mehr das Europäische Parlament, während sich der Rat als Bremsklotz erwies.
Autor:innen: Elena Ellmeier und Felix Mayr
Diesen Artikel downloaden
Neokoloniale Abhängigkeiten
Der Globale Norden hat eine historische Verantwortung in mehrerlei Hinsicht. Zunächst sind einige Länder – Spanien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande etc.- ehemalige Kolonialmächte. In Ländern des Globalen Südens hinterließ das Kolonialerbe negative Spuren. Diese Länder fungieren bis heute vorrangig als Rohstofflieferanten. Ihr Rohstoffreichtum hat sich allzu oft für sie als Nachteil herausgestellt, weshalb gerade die Länder mit den meisten und wertvollsten Rohstoffen häufig zu den ärmsten gehören. Aber wieso eigentlich? Plakativ lässt sich diese Problematik am Beispiel des Schweizer Konzerns Glencore im Tschad, einem der ärmsten Länder weltweit, darstellen. Glencore gewährte dem Tschad einen Kredit von 1,45 Milliarden US-Dollar, den das Land in Form von Rohstoffen zurückzahlen sollte. Durch den fallenden Ölpreis musste der Tschad beinahe seine gesamte Ölproduktion an Glencore übergeben. Damit hat sich das Land nicht nur enorm verschuldet, so flossen auch hohe Gewinne im Ölbereich an den Großkonzern. Kein Wunder also, dass Glencore im Jahr 2022 einen Gewinn von 17,3 Milliarden verzeichnen konnte- das 1,4-fache des BIPs vom Tschad in dem Jahr. Um sich Gewinne zu sichern, scheuen Konzerne wie Glencore auch nicht vor dreister Korruption zurück, wie jüngste Beispiele zeigen.
Neuausrichtung der EU-Handels- und Investitionspolitik notwendig
Auch die Handelspolitik der EU mit ihrer Liberalisierungsagenda zementiert die bestehenden Ungleichgewichte ein. Die Handelsabkommen der EU mit afrikanischen Ländern, die sogenannten EPAs, verbieten beispielsweise Ausfuhrsteuern für Rohstoffe. Dadurch können afrikanische Länder nicht ausreichend Anreize bieten, um selbst von ihrem Rohstoffvorkommen zu profitieren und durch eigenständige Verarbeitung ihre Industrialisierung voranzutreiben. Außerdem sollen mit diesen Abkommen nicht konkurrenzfähige afrikanische Märkte für europäische Konzerne geöffnet werden. Das hat zur Folge, dass einige afrikanische Länder mit europäischem Billig-Hühnerfleisch überschwemmt werden, was lokale Anbieter in den Ruin treibt. Aber auch die Handels- und Investitionsabkommen mit lateinamerikanischen Ländern, z.B. mit Chile und dem Mercosur, folgen immer noch einer veralteten Doktrin der einseitigen Liberalisierung und verschärfen so die Abhängigkeit. Anstatt Länder des Globalen Südens in ihrer Entwicklung zu unterstützen, soll ihr Status als Rohstofflieferanten auf Kosten von Umwelt und Beschäftigten gesichert werden. Chile soll Lithium und Kupfer liefern, das dort unter verheerenden Arbeitsbedingungen abgebaut wird, während Chile im Gegenzug Autos und Chemikalien aus der EU importieren soll. Konzernen werden außerdem Sonderklagerechte eingeräumt, die demokratische Institutionen aushebeln und progressiver Politik im Weg stehen. Diese neoliberale Doktrin ist in der Handelspolitik der EU fest verankert und bedient vor allem die Interessen der Konzerne statt von breiten Teilen der Bevölkerung weltweit.
Vor dem Hintergrund dieser Missstände wird klar, dass die EU nicht nur eine historische, sondern auch eine allgemeine Verantwortung gegenüber den Menschen und dem Klima, nicht nur in Europa, sondern auch in den Entwicklungsländern hat. Deshalb muss sie gerade Unternehmen endlich in die Pflicht nehmen. Auf Basis des gesellschaftlichen Drucks in Klima- und sozialen Fragen von Gewerkschaften, NGOs und Zivilgesellschaft und insbesondere auch ein fortschrittliches Europäisches Parlament sind dahingehend auch Vorstöße möglich gewesen. Aber auch bei den nachfolgenden Beispielen wird klar, dass die nationale und internationale Konzernlobby wieder kräftig mitmischen durfte und wichtige Initiativen dementsprechend verwässert wurden.
Das EU-Lieferkettengesetz
Die Sorgfaltspflicht umschreibt die Verantwortung von Unternehmen, Missstände in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschäden vorzubeugen bzw. abzustellen. Man spricht deshalb auch von “Bemühungspflichten”, da diese Pflichten unabhängig davon einzuhalten sind, ob ein Schaden eintritt oder nicht. Da sich jedoch in der Vergangenheit unverbindliche Leitsätze und Prinzipien der UN und der OECD in der Praxis nicht bewähren konnten, hat die EU nach nationalen Gesetzen in Frankreich und Deutschland ein eigenes “EU-Lieferkettengesetz” Anfang 2022 vorgelegt, das bei Missachtung auch Sanktionen vorsieht. Die Kommission hat allerdings bereits im Vorfeld die Einflussnahme von Konzernen über die Einrichtung undurchsichtiger Ausschüsse begünstigt, wodurch der 2022 präsentierte Vorschlag bereits schwach ausfiel.
Nachdem die ursprüngliche Einigung zwischen EU-Parlament und Rat nach der angekündigten Enthaltung Deutschlands keine Mehrheit mehr im Rat fand, wurde mit 15. März schließlich doch noch vor den EU-Wahlen eine Einigung erzielt. Für diesen Kompromiss wurden jedoch schmerzhafte Zugeständnisse gemacht: Ein viel zu hoch angesetzter Schwellenwert (mehr als 1000 Mitarbeiter:innen und mehr als 450 Mio. Jahresumsatz) sowie eine unverhältnismäßig lange Übergangsfrist stehen dem sich selbst gesteckten Ziel von sauberen Lieferketten im Weg: So sind um 70% weniger Unternehmen als ursprünglich angedacht betroffen. Forderungen des Parlaments – insbesondere eine Einbeziehung des Finanzsektors, materielle Sorgfaltspflichten in Bezug auf Klimaschutz sowie strengere Haftungen und einen weiter gefassten Anwendungsbereich der Richtlinie – konnten sich auch im finalen Text nicht durchsetzen.
Das Zustandekommen einer Einigung ist auch der Arbeit von Gewerkschaften, NGOs und Unterstützer:innen der europaweiten Kampagne „Gerechtigkeit geht alle an“ (Justice is Everybody’s Business) zu verdanken, zu denen auch die AK und der ÖGB zählen. Österreichs Regierungsarbeit in der Initiative war dabei einmal mehr beschämend: Der Rückzieher des Bundesministers Kocher nach der Enthaltung Deutschlands in der Sache hat insofern einmal mehr für Diskussionen in der Koalition gesorgt. Die dennoch erreichte Einigung rief trotz einer weitgehenden Abschwächung lautstarken Protest der Industrie herbei: so sprach BusinessEurope-Chef Markus Beyrer zuletzt von einem ”Regulierungs-Tsunami“ vonseiten der EU – zu dessen Lösung sie aber “sehr viele Vorschläge machen” würden. Aus gutem Grund wurde BusinessEurope wegen seiner engen Kontakte zur Kommission bereits als der ”Todesstern” der Konzernlobbys genannt.
Die EU-Entwaldungsverordnung
Auf globaler Ebene gingen seit 1990 mehr als 420 Millionen Hektar Wald verloren – eine Fläche größer als die EU. Die EU selbst gilt mit einem weltweiten Anteil von 10% als zweitgrößte Importeurin von Produkten, die mit Entwaldung in Verbindung stehen. Insofern ist es begrüßenswert, dass mehr Verantwortung für das Konsumverhalten übernommen werden soll: Nach der ab 2025 anzuwendenden EU-EntwaldungsVO sollen künftig relevante Rohstoffe (Rind, Kakao, Kaffee, Ölpalme, Kautschuk, Soja, Holz) und Erzeugnisse daraus (z.B. Leder, Schokolade, Zellstoff und Papier) nur mehr dann auf den EU-Markt gebracht oder exportiert werden, wenn sie u.a. nicht auf entwaldeten Flächen erzeugt wurden. Denn 90% der weltweiten Entwaldung gehen auf landwirtschaftliche Nutzung zurück. Die Definition von „Entwaldung“ ist allerdings sehr eng gefasst, was einen ersten Schwachpunkt der Verordnung darstellt. Darüber hinaus sind Rohstoffe wie Zuckerrohr und Mais nicht in der Verordnung enthalten; ebenso wenig werden Savannen oder Feuchtgebiete vom Entwaldungsbegriff erfasst.
Anstatt eine wirksame und effektive Vollziehung der Maßnahme ab nächstem Jahr in Österreich vorzubereiten, versuchte Bundesminister Totschnig zuletzt die Verordnung in einem informellen Treffen der EU-Landwirtschaftsminister:innen ohne vorhergehende Koordinierung erheblich abzuschwächen – zum Wohlgefallen der Wirtschaftsverbände, die sich gerne auf Seiten der kleinen und mittelständigen landwirtschaftlichen Betriebe inszenieren, um anschließend genau diesen durch eine fehlgeleitete Agrarpolitik zu schaden. Denn Billigprodukte aus Drittstaaten setzen wiederum heimische Landwirt:innen unter Druck, darunter insbesondere Kleinstbetriebe. So würde die effektive und lückenlose Kontrolle der Einhaltung der Entwaldungsverordnung ab 2025 die heimische Landwirtschaft und insbesondere kleinere Betriebe tendenziell stärken. Die in Österreich zuständige Behörde gab jedoch zuletzt auf Anfrage an, dass man bislang noch nicht einmal ermittelt habe, wie viele Stellen für die Vollziehung ab 2025 notwendig sein werden.
Die Verordnung allein wird das Problem der zunehmenden Entwaldung wohl nicht beseitigen können. Dennoch ist mit der Initiative ein wichtiges Zeichen des Bewusstseins für die Problematik einerseits und der Verantwortung am derzeitigen Waldsterben andererseits gesetzt. Ebenso sind bereits Entscheidungsträger:innen in z.B. den USA auf die Initiative aufmerksam geworden, womit ein sog. „Brüssel-Effekt“ nicht auszuschließen ist: damit wird jener Umstand benannt, nach dem multinationale Konzerne aus Praktikabilitätsgründen statt nach unterschiedlichen Standards bloß nach dem strengsten Standard herstellen, und das ist meist der EU-Standard. Wünschenswert wären dennoch weitergehende, internationale Kooperationen der EU zur Eindämmung des globalen Waldsterbens.
Die Zwangsarbeitsverordnung
Kürzlich wurde von der EU die Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten verabschiedet. Damit wurde erstmals ein europaweites Instrument zur Bekämpfung von Zwangsarbeit geschaffen, von der weltweit in etwa 28 Mio. Menschen direkt, insgesamt 50 Millionen Menschen indirekt betroffen sind. Aber auch innerhalb der EU betrifft Zwangsarbeit nach wie vor weit mehr Menschen als herkömmlich angenommen: als ein bekanntes Beispiel kann die Landwirtschaft genannt werden, in welcher neben Arbeits- auch sexueller Missbrauch am Beispiel von marokkanischen Saisonarbeiterinnen dokumentiert wurde. Die Situation der von Zwangsarbeit betroffenen Menschen hat sich weltweit im Zuge der COVID-19-Pandemie zusätzlich verschärft. Vor dem Hintergrund dieses verheerenden Ausmaßes an modernen Formen von Sklaverei wird die Maßnahme ausdrücklich begrüßt.
Auf EU-Ebene war man sich jedoch über die Herangehensweise nicht immer einig: im Gegensatz zum Rat, der vor allem die Wirtschaftsakteure unter dem Vorwand von Bürokratielasten schützen wollte, drängte das Parlament bspw. darauf, dass ein Produktverbot aufgrund von nachgewiesener Zwangsarbeit erst aufgehoben werden darf, wenn den betroffenen Zwangsarbeiter:innen Wiedergutmachung gewährt wurde. Ohne Wiedergutmachungszahlungen würde die Verordnung die Gefahr bergen, dass sich Unternehmen von Geschäftspartner:innen nach Missständen lösen, ohne dass eine Verbesserung für die Betroffenen eintritt. Dass die Verordnung rein auf das Verbot von Produkten und nicht auch auf die Verbesserung der Situation der Betroffenen abzielt, scheint insofern zu kurz gedacht. So sieht der derzeitige Kompromiss nur freiwillige Wiedergutmachungszahlungen vor. Darüber hinaus wollte das EU-Parlament eine Beweislastumkehr in die Verordnung einbetten, wonach Unternehmen selbst nach einem begründeten Anfangsverdacht nachweisen müssen, dass keine Zwangsarbeit vorliegt. Dies ist insofern entscheidend, da ein Sammeln von notwendigen Beweisen auch für Behörden nicht immer möglich ist, wie insbesondere im Fall von staatlich angeordneter Zwangsarbeit deutlich wird. Zudem sieht die EU-Verordnung eine höhere Schwelle für das Sammeln von Beweisen vor als der vergleichbare US-Tariff-Act, was einer Aufarbeitung von Missständen abträglich ist. AK-Forderungen, in denen auf diese Probleme hingewiesen wurden, wurden jedoch von Bundesminister Kocher ignoriert.
Ausblick
Die genannten Maßnahmen verdeutlichen, dass Vorstöße auf Druck der Bevölkerung, von Gewerkschaften und NGOs möglich sind. Dabei hat sich das Europäische Parlament als konstruktiver Bündnispartner erwiesen. Allerdings veranschaulichen auch diese Beispiele, wie mächtig die Lobbys der Konzerne und Unternehmen auf nationaler und EU-Ebene sind und wie groß deren Mitspracherecht in politischen Entscheidungsprozessen ist. So fanden Einigungen im Trilog (Treffen der gesetzgebenden EU-Gremien) in insbesondere für Wirtschaftsverbände unliebsamen Initiativen plötzlich keine Mehrheit mehr im Rat. Daraus kann man schließen, dass unternehmensnahe Lobbys ihren Druck direkt auf Entscheidungsträger:innen der Mitgliedstaaten ausgeübt haben, wenn sie sich bei EU-Parlamentarier:innen nicht durchsetzen konnten. Viele wichtige Initiativen wurden dementsprechend verwässert. Insbesondere Österreich nahm in diesen Manövern eine besonders rückschrittliche Rolle ein: So drängten heimische Minister in jeder der genannten Fälle auf eine weitestgehende Abschwächung der Maßnahme. Um eine gerechte und konsequente Umgestaltung der Weltwirtschaft bewältigen zu können, braucht es deshalb eine weitere Aufwertung des Europäischen Parlaments (z.B. volles Initiativrecht bei Gesetzgebungsverfahren) und generell eine Transparenzmachung der Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene. Um nicht länger die Interessen der Konzerne, sondern die der Menschen zu bedienen, muss die Unternehmenslobby auf EU-Ebene zurückgedrängt werden. Nur so kann ein sozial-ökologischer Umbau gelingen.
Diesen Artikel downloadenKontakt
Kontakt
Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien
Abteilung EU & Internationales
Prinz Eugenstraße 20-22
1040 Wien
Telefon: +43 1 50165-0
- erreichbar mit der Linie D -

